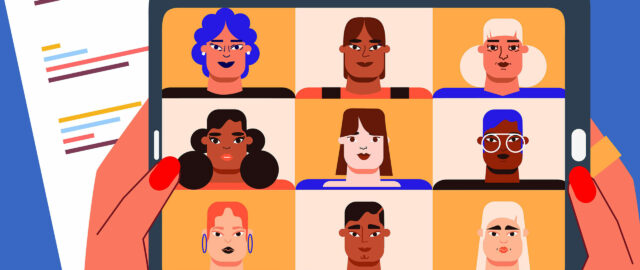Low Tech, High Touch – wenig Technik, viel Kontakt. Diese Haltung kennzeichnet Palliative Care im Kontrast zur klassischen Medizin. Letztere hat das Ziel, Krankheiten zu heilen. Palliativversorgung begleitet unheilbare Patientinnen und Patienten in ihrer letzten Lebensphase. Sie tut dies ganzheitlich und zugewandt. Dafür arbeiten unterschiedliche Professionen auf einer Palliativstation eng zusammen: Ärztinnen und Ärzte, Pflegende, Case-Management und Sozialdienst, Kunst- und Musiktherapie, Seelsorge, Psychologie und Physiotherapie.
Die Arbeit in den multiprofessionellen Teams ist komplex. Alle Fachkräfte kümmern sich intensiv um jede einzelne Patientin und jeden Patienten, ebenso um deren Angehörige. Ein Palliativteam ist zudem täglich mit vielen Informationen konfrontiert, die sachlich und emotional verarbeitet und sorgfältig dokumentiert werden müssen. In der wöchentlichen Teambesprechung, dem zentralen Ort der Behandlungsplanung, berichtet etwa die Ärztin über die starken Schmerzen eines Patienten. Der Seelsorger erzählt, dass dieser Patient große Angst vor dem Tod habe. Die Psychologin weiß von der Sorge des Patienten um seine Familie.
Forschungsprojekt
Bestehende technologische Systeme? Nicht optimal
„Für den flüssigen Informationsaustausch in Palliativteams sind die bestehenden technologischen Systeme im Gesundheitsbereich nicht ausgelegt. Das gilt für die Software und für die Hardware“, beschreibt der Wirtschaftsinformatiker Professor Dr. Henner Gimpel vom Fraunhofer-Institut für Angewandte Informationstechnik. Er gehört zur interdisziplinären Forschungsgruppe des vom bidt geförderten Projekts „Palliative Care als digitale Arbeitswelt: Perspektiven und Gestaltungsmöglichkeiten der digitalen Transformation von Kommunikations- und Kollaborationsprozessen in der multiprofessionellen Versorgung der letzten Lebensphase“ (PALLADiUM).
Das Projekt vereint Perspektiven aus Wirtschaftsinformatik, Soziologie und Medizin. Durch den interdisziplinären Ansatz entstehen wertvolle Impulse für eine Verbesserung der als „technikfern“ geltenden Arbeitswelt. Dr. Sarah Peuten von der Universität Augsburg nimmt die soziologische Perspektive ein. „Konkret wollen wir herausfinden, wie man die jeweils relevante Informations- und Wissenslage für alle Mitarbeitenden eines Palliativteams mithilfe eines digitalen Assistenzsystems aufrechterhalten kann – unabhängig von den gemeinsamen Besprechungen und unter Berücksichtigung der multiprofessionellen Zusammenarbeit.“ Die unterschiedlichen Professionen sollen möglichst zu jedem Zeitpunkt über ein gemeinsam geteiltes Fallverständnis verfügen und so optimal im Sinne der Patientinnen und Patienten handeln können.
Die Fachkräfte der Palliative Care haben aufgrund ihrer Profession jeweils einen anderen Blick auf die Patientinnen und Patienten.
 Dr. Sarah Peuten Zum Profil
Dr. Sarah Peuten Zum Profil
Die richtige Dosierung von Technik
Dr. Tobias Steigleder ist Oberarzt der Palliativstation des Universitätsklinikums Erlangen. „In der letzten Lebensphase geht es vor allem um die Symptomlinderung. Dafür ist soziale Teilhabe unser wichtigstes therapeutisches Instrument, unterstützt von medikamentöser Therapie. Unsere Herausforderung ist: Jede soziale Teilhabe wird durch die Präsenz von Technik gestört. Das kann ein trivialer Infusionsständer sein. Wenn man zusammensitzt – mit der Psychologin, dem Therapeuten, den Angehörigen –, wird der Blick immer wieder zur Infusion wandern, ob sie noch tropft. Das Miteinander ist abgelenkt. Deshalb ist unser Arbeitsfeld technikarm gestaltet.“
Die Forschenden des bidt-Projekts begleiteten über mehrere Wochen die Arbeit des Palliativteams in Erlangen, um
- die Prozesse in der multiprofessionellen Zusammenarbeit kennenzulernen,
- Anforderungen an ein digitales System zur Unterstützung der Kommunikations- und Kollaborationsprozesse aufzustellen sowie
- erste Umsetzungskonzepte zu entwickeln.
Die Arbeit der Palliativmedizin orientiert sich an den subjektiv wahrgenommenen Beschwerden der Patientinnen und Patienten. Tobias Steigleder sagt: „Wir müssen permanent beurteilen: Welcher Patient braucht wen oder was jetzt gerade? Diese Einschätzung nimmt das Palliativteam am Tag wiederholt vor und daraus entsteht ein Gesamtbild.“ Alle relevanten Daten und Informationen dokumentieren die Mitarbeitenden zwar digital, doch die Nutzungsmöglichkeiten sind begrenzt. „Wir verwenden ein digitales Informationssystem, zum Beispiel um Laborwerte abzufragen. Aber die Patientenversorgung selbst wird bisher kaum digital unterstützt.“
Hier ergeben sich Potenziale für Innovation, glaubt der Mediziner. „Unsere Datensammlung ist enorm, aber wir können sie mit unseren technologischen Systemen nicht optimal nutzen.“ In der Palliativabteilung des Universitätsklinikums Erlangen arbeiten pro Schicht 15 Leute zusammen. „Könnten wir deren Austausch untereinander teilweise an ein digitales Assistenzsystem übergeben, wäre das eine erhebliche Arbeitserleichterung, die letztlich den Patientinnen und Patienten zugutekommt.“
Wichtig ist, dass jede Technologie nur im Hintergrund unterstützt, was die multiprofessionellen Palliativteams tagtäglich in der unmittelbaren Patientenversorgung leisten.
 Dr. Tobias Steigleder Zum Profil
Dr. Tobias Steigleder Zum Profil
Digitalisierungschancen in der Palliative Care
Das Projektteam konnte anhand von teilnehmenden Beobachtungen, Fokusgruppen und Interviews mit den Mitarbeitenden der Palliativstation wesentliche Chancen und Herausforderungen der Digitalisierung in der Palliative Care identifizieren:
Informations- und Wissensbrüche vermeiden
In der Flut der Dokumentation gehen wichtige Informationen unter. Durch den Einsatz sinnvoller Technologie könnten Daten besser verarbeitet und nutzbar gemacht werden, etwa indem man sie zusammenführt und Redundanzen vermeidet. Zudem haben die Professionen verschiedene Informations- und Wissensbedarfe. Informationen ließen sich digital professionsspezifisch aufbereiten, damit alle im Team genau die Informationen bekommen, die sie für eine optimale Behandlungsplanung und Patientenversorgung brauchen.
Aktualitätsverzerrungen in Besprechungen verhindern
Wenn die multiprofessionellen Mitarbeitenden in Besprechungen zusammenkommen, treten die aktuellen Ereignisse in den Vordergrund. Sie können das Gesamtbild eines Falls verzerren, schlicht weil nicht alle Informationen der letzten Tage und Wochen immer bei allen Mitarbeitenden „auf dem Schirm” sind. Das, was in den Tagen zuvor für die Patientin oder den Patienten oder das Team wichtig war, rückt in den Hintergrund. Ein digitales Assistenzsystem könnte dabei helfen, auch weniger aktuelle Informationen in Teambesprechungen stets präsent zu haben.
Entscheidungsverzerrungen umgehen
Im Krankenhaus, auch in der Palliativpflege, gibt es eine deutlich hierarchische Struktur, das heißt, verschiedene Personen- und Berufsgruppen haben an unterschiedlichen Stellen „etwas zu sagen“. So entsteht eine Gewichtung von Informationen, die die tatsächliche Situation eines individuellen Falls nicht objektiv abbildet. Ein positiver Effekt eines digitalen Assistenzsystems wäre die Demokratisierung: Alle Mitarbeitenden hätten die Möglichkeit, ihr Fallwissen gegenüber den Kolleginnen und Kollegen gleichwertig sichtbar zu machen.
Nichtstörräume respektieren
Es gibt Situationen, in denen die Grenzen der Digitalisierung dieser Arbeitswelt sehr deutlich werden. Denn einige Gespräche oder Informationen kann und möchte man nicht über ein technisches System kommunizieren oder dokumentieren. Zudem können Fürsorge und Nähe für die Patientinnen und Patienten – ebenso wie im Team untereinander – nicht technisch ersetzt werden.
Im Test: Ein digitales Assistenzsystem für die Palliative Care
Für die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler des bidt-Projekts ist klar: Empfinden die Mitarbeitenden auf der Palliativstation ein neues, digitales Assistenzsystem als zusätzlichen Aufwand, wird es nicht genutzt. Sarah Peuten beschreibt: „Vor allem aus ärztlicher und pflegerischer Perspektive ist das ein großes Thema. Sie sagen: Wir ertrinken jetzt schon in Dokumentationsvorgaben. Uns geht die Zeit am Patienten verloren oder für den so wichtigen Teamaustausch. Der Mehrwert eines Systems muss so in den Vordergrund rücken, dass es nicht als Belastung empfunden wird.“
Bei der Gestaltung des Assistenzsystems orientiert sich das Projektteam deshalb an gewohnten, modernen App-Designs. Henner Gimpel beschreibt: „Mit mobilen Endgeräten könnte man die Arbeitsabläufe vereinfachen und die Qualität der eingegebenen Informationen erhöhen. Aber der Umgang mit dem neuen digitalen System muss sehr leicht und intuitiv sein.“ Herauskommen soll eine App, die auf normalen Smartphones und Tablets läuft. „Mitarbeitende der Palliativstation sehen dort zum Beispiel, dass der Schmerz des Patienten über die letzten vier Tage zugenommen hat. Dann kann man in der App in die Tiefe klicken: Hat jemand dokumentiert, was für ein Schmerz das ist? Wie haben sich die Medikamente geändert? Im Rahmen des Projekts bringen wir aber keine reife Software raus, sondern testen unseren technischen Prototyp erstmal umfassend in der Praxis.“ Der Prototyp befindet sich gerade in der Entwicklung.
Die Oberfläche des digitalen Systems muss für viele Mitarbeitende funktionieren, die sich nicht primär mit Technik beschäftigen, sondern sich um Patienten und Angehörige kümmern wollen.
 Prof. Dr. Henner Gimpel Zum Profil
Prof. Dr. Henner Gimpel Zum Profil
Geplante Funktionen des digitalen Assistenzsystems:
- Alle Mitarbeitenden eines Palliativteams verwenden eine App auf ihren beruflich genutzten mobilen Endgeräten als Reflexionsfläche für das persönliche Fallwissen.
- Das digitale System schafft eine gemeinsame Diskussionsgrundlage, etwa für Teambesprechungen.
- Mitarbeitende können entscheiden, ob eine neue Information gespeichert oder zeitgleich direkt an jemanden geschickt wird: eine Mischung aus einem gemeinsamen Notizbuch und Instant-Messaging-System.
- Mittels Pop-up-Benachrichtigungen werden aktuell wichtige Informationen an einzelne Mitarbeitende ausgespielt, zum Beispiel wenn jemand Hilfe braucht oder den aktuellen Arbeitsplan betreffend.
- Informationen werden mithilfe einer Künstlichen Intelligenz professionsspezifisch aufbereitet und in der App angezeigt (perspektivisch vielleicht sogar personenspezifisch).
Digitalisierung der Palliativversorgung – oder digitale Transformation?
Sollen neue digitale Systeme in der Palliative Care erfolgreich eingeführt werden, muss das mit Respekt vor dieser traditionell technikfernen Arbeitswelt geschehen. Ist „digitale Transformation“ – wie der Projekttitel andeutet – dann nicht zu viel verlangt? „Die Palliativmedizin entwickelte sich in den 50er‑ und 60er‑Jahren als Gegenpol zur zunehmend technisierten Intensivmedizin. Wir nutzen natürlich technische Hilfsmittel, zum Beispiel zur Dokumentation. Aber aufgrund der Historie unseres Arbeitsfeldes ist fast jede Digitalisierung eine digitale Transformation“, erklärt Tobias Steigleder.
Sarah Peuten ergänzt: „Die Akzeptanz ist heute – aufgrund der Entwicklung des Feldes – noch relativ gering. Umso wichtiger ist es, die richtige Technologie zu entwickeln und deutlich zu machen, dass es immer um ein Unterstützungssystem geht. Die menschliche Arbeit sowie das Engagement können und sollen nicht ersetzt werden.“ Selbstverständlich bleibe ein Palliativteam auf den mündlichen Austausch untereinander angewiesen: Die Verarbeitung und Bewältigung von teilweise belastenden Situationen könne nicht digital geschehen. „Häufig müssen die Mitarbeitenden etwas ganz akut mit jemandem besprechen, weil sie eine Entscheidung oder Feedback brauchen.“ Auch das könne ein digitales Assistenzsystem nicht abbilden. „Es kann aber mehr Freiräume genau für solche Situationen schaffen, weil es den Workload an anderer Stelle reduziert.“
Welche Rolle spielt der Datenschutz?
Für den technischen Prototyp des bidt-Projekts stellt das Universitätsklinikum Erlangen anonymisierte Daten zur Verfügung, die in der Forschung genutzt werden können. „Beim späteren Einsatz in der Palliativversorgung agieren wir rechtlich innerhalb eines professionellen Umfelds, in dem es klare Datenschutz- und Verschwiegenheitsregeln gibt“, stellt der Wirtschaftsinformatiker Henner Gimpel fest. Zugleich beschäftigt sich das Forschungsteam mit möglichen Bedenken der Stakeholder in Bezug auf den Datenschutz. „Es gibt einen starken Gate-Keeping-Effekt: Die potenziellen User fragten uns direkt am Anfang, was das für den Datenschutz der Patientinnen und Patienten bedeutet. Die Privatsphäre soll geschützt werden, denn es geht um sensible Patientendaten“, berichtet Sarah Peuten.
Oberarzt Tobias Steigleder fügt hinzu: „Wir haben in Erlangen eine Patient-Public-Involvement-Initiative, die auch Forschung mitgestaltet. Deren Perspektive ist interessant: Es gibt bei Patienten und Angehörigen wenige Befindlichkeiten, sondern ein Vertrauen, dass Daten verantwortungsvoll genutzt und geteilt werden. Sie sehen die Notwendigkeit, dass jeder Akteur die Daten kennt, um die persönliche Gesundheitsversorgung zu verbessern. Und es ist klar, dass Digitalisierung vorrangig die Zusammenarbeit des medizinisch-pflegerischen Personals betrifft – damit dieses sich voll und ganz auf die Patienten konzentrieren kann.“
Das bidt-Projekt schafft wichtige Grundlagen
Dank des wissensbasierten, praxisnahen Ansatzes des Projekts lassen sich die Erkenntnisse in andere Kontexte übersetzen, in denen sich aufgrund der multiprofessionellen Zusammenarbeit ähnliche Herausforderungen auftun, etwa Geriatrie, stationäre und häusliche Altenpflege und ambulante Palliativversorgung. Für das Projektteam ist Palliative Care ein enorm spannendes Feld, betont Sarah Peuten. „Hier gibt es wenig Digitalität und keine große Begeisterung für Techniknutzung. Da können wir viele Grundlagen schaffen und leisten mit unserem Prototyp wertvolle Basisarbeit.“