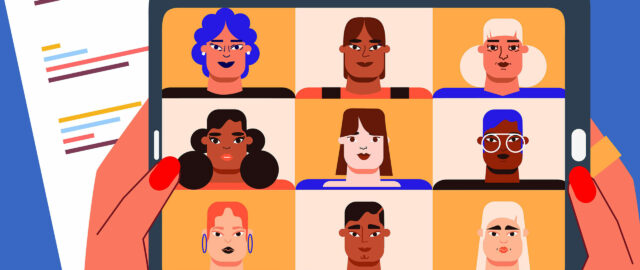Worauf kommt es bei der digitalen Transformation an?
Stefan Vilsmeier: In der Medizintechnik sind drei Säulen entscheidend: erstens die Technologie an sich – also die Soft- und Hardware, zweitens der Zugang zu Daten und drittens der Wandel in den Köpfen der Menschen. Mir war bereits sehr früh klar, dass insbesondere die dritte Säule – und damit verbunden die Informationsvermittlung und das Training rund um neue Technologien – einen hohen Stellenwert hat. Aus diesem Grund haben wir damals als noch sehr kleines Unternehmen beispielsweise in Aus- und Fortbildung investiert und heute sind Trainings oder auch Hackathons eine wichtige Säule.
Was bedeutet es eigentlich, die Chirurgie zu digitalisieren?
Im Grunde möchte man die Position eines Instruments genau erfassen – aber auch verstehen, wie das Ganze mit der Patientin bzw. dem Patienten agiert. Unsere Medizintechnik funktioniert wie eine Art GPS-System: Wo befindet sich das Instrument während einer OP gerade? Welche Struktur ist links, welche rechts? Was passiert, wenn die behandelnde Ärztin drei Millimeter tiefer geht? Wir haben die Patienten kartografiert und diagnostische Daten, beispielsweise von Computertomografien und Kernspintomografien, in einem Modell zusammengeführt. Beispielsweise können so bei einem Unfallpatienten Implantate genau platziert werden.
KI, VR und Robotics – können neue Technologien den Mediziner ersetzen?
Heute eröffnet der Einsatz von Künstlicher Intelligenz, Virtual Reality und Robotik völlig neue andere Möglichkeiten, als es noch vor zehn Jahren der Fall war. Gerade im Bereich der Robotik denken aber manche: Wenn der Roboter das macht, dann ist das alles viel besser. Aber ganz zu Beginn muss man überlegen: Welches Problem möchte ich ganz konkret lösen? Wird die Operation durch den Einsatz von Robotern schneller, sicherer, kostengünstiger und schonender für den Patienten? Manchmal ist genau das Gegenteil der Fall. Die ganzen Roboter sind vielmehr Assistenzsysteme, die beispielsweise den Chirurgen unterstützen, indem der Roboterarm während der Operation etwas hält. Das Gleiche gilt für KI – sie kann helfen, CT-Scans oder Röntgenbilder zu analysieren und eine Vordiagnose zu geben. Die Mediziner tragen aber weiterhin die Verantwortung und entscheiden.

Sie sprechen die Datennutzung in der Medizintechnik an – was muss hier beachtet werden?
Transparenz ist hier enorm wichtig und damit verbunden die Frage: Wer macht wo was mit meinen Daten? Ich spreche da als Unternehmer, aber auch als Bürger und potenzieller Patient – und da möchte ich mich natürlich damit wohlfühlen, was mit meinen Daten passiert. Daten sollten aus meiner Sicht auch möglichst breit verteilt sein, das heißt, nicht eine zentrale staatliche Instanz wacht über alle Daten, sondern ich sehe große Chancen in einem verteilten dezentralen System mit vielen Akteuren
Wichtig sind standardisierte und transparente Schnittstellen. Gute Ansätze sind diejenigen, welche die Bürgerinnen und Bürger ins Zentrum stellen.
 Stefan Vilsmeier, CEO Brainlab AG
Stefan Vilsmeier, CEO Brainlab AG
Was kann denn Datennutzung in der Medizintechnik bewirken?
Bei Parkinson kann beispielsweise mit mechanischen Zielgeräten eine Elektrode in einen bestimmten Bereich des Gehirns platziert werden. Wenn wir die Daten von ausreichend vielen Patientinnen und Patienten sammeln, kann man viel besser für die Deep Brain Stimulation den sogenannten Sweetspot identifizieren – also den Bereich, wo gezielt stimuliert werden muss. Wenn dank vieler Patientendaten dieser Punkt besser gefunden wird, dann reduziert sich die Dauer der OP von vorher acht Stunden auf eine Stunde – die Belastung für den Patienten nimmt spürbar ab.
Inwiefern spielt die Diversität der Daten eine Rolle?
Grundsätzlich braucht man immer Daten von sehr guter und nachvollziehbarer Qualität. Aber die Gewinnung von Daten ist nicht immer einfach – gerade bei klinischen Studien gibt es oft sehr enge Kriterien – und es kann vorkommen, dass diese nicht breit genug gewählt werden. Auch dass Daten von vielen unterschiedlichen Menschen, beispielsweise im Hinblick auf Alter oder Geschlecht, in die Entwicklung von neuen Technologien einfließen, ist wichtig. Wenn zum Beispiel ein Algorithmus zur Erkennung von Hautkrebs nur mit Daten von hellhäutigen Menschen trainiert wird, dann erkennt er eben nicht zuverlässig mögliche Krebsstufen auf dunkler Haut und es kommt zu Fehldiagnosen. Das ist ein Beispiel, wo man gezielt an der Datenqualität arbeiten muss.

Welche Rolle kommt Datenspenden zu?
Bisher befinden sich die Daten, die bei uns eingesetzt werden, auf den Systemen unserer Anwender – also den Kliniken. Sie werden von ihnen verwaltet und für die Primärnutzung eingesetzt. Wir als Hersteller haben erst einmal gar keinen Zugriff auf die Daten. Die große Chance wäre natürlich die Sekundärnutzung, damit man nicht nur die konkrete Krankheit des individuellen Patienten optimal behandeln kann, sondern dass auch darüber hinaus Akteure außerhalb der Krankenhäuser Innovationen – beispielsweise für die Behandlung von Krebsleiden – vorantreiben können. Spannend ist beispielsweise aktuell das BORN-Projekt des Bayerischen Zentrums für Krebsforschung: Hier erfolgt erstmals die Erhebung von Gesundheitsdaten von Anfang an standardisiert, strukturiert und prozessorientiert, um eine weltweit einmalige Datengrundlage zur Entwicklung bildbasierter Biomarker und maschineller Lernverfahren der KI zu schaffen.



Wie könnte hier die Datennutzung vereinfacht werden?
Zunächst einmal: Es ist gut und richtig, dass Daten nur mit einer entsprechenden Einwilligung des Patienten gesammelt werden können. Bei einem Krankenhausaufenthalt wird allerdings den Patienten aktuell im Hinblick auf die entsprechenden Einwilligungen viel Papierarbeit zugemutet. Viele Seiten müssen vor Ort durchgelesen und unterschrieben werden – da kann die Patientin oder der Patient schnell den Überblick verlieren – das gilt auch für Widerrufsmöglichkeiten.
Aus meiner Sicht könnte man hier vieles vereinfachen; zum Beispiel, indem für die Einwilligung zur Datennutzung wie beim Organspendeausweis ein Datenfreigabepass eingeführt wird.
 Stefan Vilsmeier, CEO Brainlab AG
Stefan Vilsmeier, CEO Brainlab AG
Was sollte dabei berücksichtigt werden?
Grundsätzliche Fragen sollten immer patientenzentriert sein: Was möchte ich als Patient erlauben? Wer darf welche Daten für welchen Zweck und mit welcher Zugangsmethorde verarbeiten? Es gibt da bereits vielversprechende Ansätze wie die Medizininformatikinitiative in Form einer einheitlichen Einwilligungserklärung zur breiten Nutzung von Patientendaten. Das Problem dabei: Die Einwilligung ist leider nicht sehr verständlich. Und aus Unternehmersicht muss ich sagen, dass dabei die Industrie als Nutzer nicht explizit angesprochen wird. Wir sind daher selbst aktiv geworden – seit zwei Jahren sind wir mit Patientenorganisationen, Politikern und Datenethikern, Juristen, Philosophen in Kontakt und entwickeln eine eigene Vorlage für eine Einwilligung. Wichtig sind der Austausch mit vielen Akteuren aus Forschung und Wissenschaft und natürlich Transparenz: Wir möchten nur die Daten in unsere Forschung einfließen lassen, die uns explizit zur Verfügung gestellt werden. Aber es wird auch deutlich: Neben der Entwicklung von Soft- und Hardware ist die Ausgestaltung der Datennutzung ein zentraler Erfolgsfaktor für den digitalen Wandel.
Vielen Dank für das Gespräch!
Das Gespräch führte Nadine Hildebrandt.